Wie ein gutes System wächst – Maintenance & Scaling

Ein Design-System ist fertig, wenn alle Komponenten funktionieren. Das glauben viele Teams. Ein gutes Design-System ist jedoch kein abgeschlossenes Projekt, sondern ein lebendes System. Und wie jedes lebendige System braucht es Pflege, Weiterentwicklung und eine bewusste Steuerung seines Wachstums.
Zeit also, den Lifecycle eines Design-Systems zu verstehen. Nicht als unvermeidliches Schicksal, sondern als gestaltbaren Prozess.
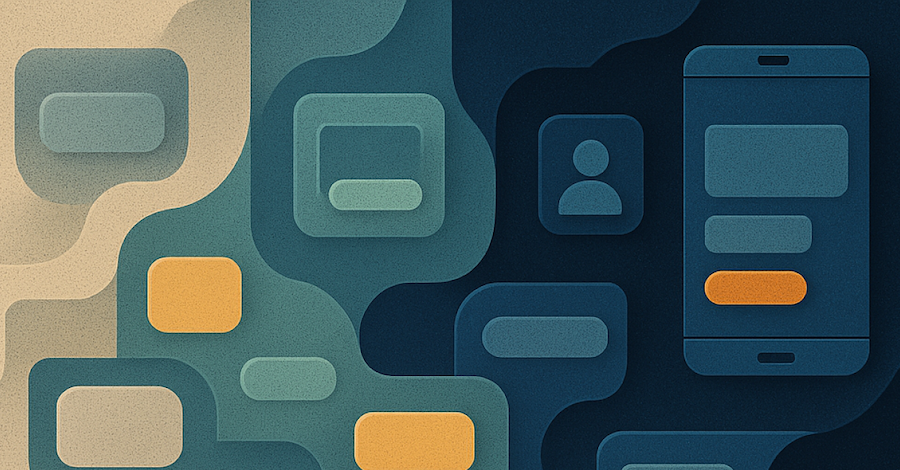
Der Lifecycle: Warum Stillstand gefährlich ist
Design-Systeme durchlaufen verschiedene Phasen. Nach der initialen Euphorie („Endlich haben wir ein System!") folgt meist die Ernüchterung: Neue Anforderungen passen nicht zu bestehenden Komponenten. Produktteams bauen wieder Einzellösungen. Das System wird langsam irrelevant.
Das Problem: Viele Teams behandeln ihr Design-System wie ein abgeschlossenes Projekt, nicht wie ein lebendiges Produkt.
Dabei ist Evolution kein Bug, sondern ein Feature. Produkte ändern sich, Nutzerverhalten entwickelt sich weiter, neue Plattformen kommen dazu. Ein System, das nicht mitwächst, verliert seine Berechtigung.
Die Kunst liegt darin, diese Evolution zu gestalten, statt ihr hilflos zuzusehen. Dafür bedarf es einer klaren Verantwortlichkeit. Ob in Form eines dedizierten Maintainer-Teams oder als Teilzeitrolle im DesignOps-Umfeld: Ohne jemanden, der sich aktiv um das System kümmert, verliert es schnell an Anschlussfähigkeit.
1. Gesundes Wachstum: Struktur statt Masse
Ein weit verbreiteter Irrtum, der auch heute noch in der Praxis besteht: Ein gutes System hat möglichst viele Komponenten. Ein überdimensioniertes System erzeugt jedoch unnötige Komplexität, erschwert den Einstieg, der Pflegeaufwand wird in die Höhe getrieben und Strukturen geschaffen, die im aktuellen Kontext vielleicht nicht mal gebraucht werden.
Stattdessen sollten neue Komponenten nur dann aufgenommen werden, wenn etwa:
- ein wiederkehrender Bedarf in mehreren Teams besteht
- sich die neue Lösung nicht aus vorhandenen Bausteinen sinnvoll kombinieren lässt
- die Pattern gemeinsam mit Devs und Designern abgestimmt sind
Mit wachsender Nutzung braucht ein Design-System klare Strukturen: Wer darf beitragen? Wie läuft der Review-Prozess? Und was kommt wirklich ins System? Unterstützend ist ein strukturiertes Contribution Model sowie eine durchdachte Versionierungsstrategie.
Ansonsten wird Wachstum schnell zum Risiko und aus einem Update wird im schlimmsten Fall ein Rollback.
2. Versionierung: Ordnung im Wandel
Best Practices:
- Eine klare Changelog-Logik etablieren (z. B. Semantic Versioning)
- Breaking Changes nur mit Vorankündigung und Migrationshilfe einführen
- Neue Komponenten optional als „Beta“ kennzeichnen – mit offenem Feedback-Kanal
- Trennung von „Stable“ und „Experimental“ Bereichen im System
Diese Mechanismen schaffen Sicherheit und Vertrauen. Entscheidend ist jedoch auch die Kommunikation. Welche Änderungen kommen wann? Was müssen Teams beachten? Neben einem guten Changelog ist klare Kommunikation und Abstimmungen Gold wert.
3. Deprecated States: Sanfter Abschied statt harter Schnitt
Dass Komponenten altern ist völlig normal. Problematisch wird es, wenn veraltete Patterns abrupt verschwinden und Produktteams im Regen stehen lassen. Besser ist hier ein strukturierter Deprecation-Prozess.
Beispiel:
Schritt 1: Komponente als „deprecated" markieren, aber funktionsfähig lassen
Schritt 2: Alternative aufzeigen und Migration-Guide bereitstellen
Schritt 3: Removal-Datum kommunizieren (mindestens 2-3 Monate Vorlauf)
Schritt 4: Komponente entfernen und Archive-Dokumentation erstellen
Dieser Prozess schafft Planungssicherheit für alle Beteiligten. Teams können Migration in ihre Roadmaps einplanen, statt von Breaking Changes überrascht zu werden.
4. Skalierung durch Design Tokens: Ein System, viele Gesichter
Tokens sorgen nicht nur für Konsistenz, sie sind der Schlüssel zur Skalierfähigkeit. Richtig eingesetzt, ermöglichen sie es, aus einem System mehrere zu machen, ohne die Wartungslast zu vervielfachen.
Anwendungsbeispiele:
- Multi-Brand-Support: Ein System, verschiedene Marken. Tokens definieren die Unterschiede (Farben, Typografie, Abstände), Komponenten bleiben identisch.
- Theming (Dark Mode & Co.): Semantic Tokens (color-background-primary) statt absolute Werte (#ffffff) ermöglichen Theme-Wechsel ohne Komponentenänderungen.
- Platform-Adaptation: Native, Web, iOS und Android verwenden oft dieselben Design-Entscheidungen, aber sie werden unterschiedlich umgesetzt. Tokens schaffen die Brücke.
Der Trick: Tokens hierarchisch strukturieren. Global Tokens definieren Basiswerte, Semantic Tokens ihre funktionale Bedeutung, Component Tokens deren konkrete Anwendung in UI-Elementen.
Beispiel:
// Global color-blue-500: #0ea5e9
// Semantic color-primary: {color-blue-500}
// Component button-background-primary: {color-primary}
So lassen sich mit wenigen Änderungen ganze Themes oder Brands erstellen.
5. Design-Code-Sync: Die ewige Herausforderung
Das größte Skalierungsproblem: Figma-Komponenten und Code-Komponenten driften auseinander.
Designer:innen erwarten, dass der Button im Browser genauso aussieht wie in Figma. Developer wundern sich über States, die im Code fehlen.
Bridging Tools können helfen: Figma to Code, Storybook-Figma-Plugin, automatisierte Tests zwischen Design und Code. Sie reduzieren manuelle Synchronisation und machen Unterschiede sichtbar.
Noch wichtiger: Cross-Team-Modelle etablieren. Regelmäßige Design-Dev-Reviews, gemeinsame Definition of Done, klare Verantwortlichkeiten für verschiedene Phasen der Komponentenerstellung.
Bewährt hat sich meist:
- Designer:innen spezifizieren Komponenten (States, Varianten, Verhalten)
- Feasibility-Check: Developer prüfen technische Umsetzbarkeit und schlagen Alternativen vor
- Developer implementieren und ergänzen technische Aspekte (Accessibility, Performance)
- Beide reviewen gemeinsam und dokumentieren Entscheidungen
6. Governance Light statt Overhead: DesignOps & Priorisierung
Nicht jedes Unternehmen braucht ein formales Design-System-Board mit dreistufiger Freigabe.
Aber: Ganz ohne Steuerung geht es auch nicht. Erfolgreiche Systeme finden oft einen Mittelweg, eine Art eine „Governance Light“:
- Ein öffentlich einsehbarer Backlog für neue Komponenten, Anfragen und Priorisierung
- Regelmäßige Reviews (z. B. zweiwöchentlich), in denen neue Vorschläge und Feedback gesammelt und evaluiert werden
- Klare Rollen und Zuständigkeiten für Wartung, Review und Freigabe
DesignOps übernimmt hier eine Schlüsselrolle: Nicht als Gatekeeper, sondern als Enabler. Sie schaffen Prozesse, die das System am Leben halten, ohne Innovationsgeschwindigkeit zu bremsen.
7. Ohne Feedback keine Relevanz: Das System lebt von seinen Nutzern
Die besten Design-Systeme entstehen nicht im Elfenbeinturm, sondern im Dialog mit ihren Nutzern. Ein gutes System hat einen offenen, kontinuierlichen Feedbackkanal und nimmt Rückmeldungen ernst.
Feedback kann auf vielen Wegen erfolgen: Slack-Channels, regelmäßige Office Hours oder gezielte User Research mit Produktteams. Wichtiger als der Kanal sind die Fragen: Wo hakt es? Was wird vermisst? Welche Workarounds entstehen?
Hinzu kommen Nutzungsdaten aus Design-Tools wie Figma, Telemetrie aus dem Code und qualitative Einblicke aus Umfragen, Interviews oder dem Support. Gemeinsam zeigen sie, was funktioniert, wo Lücken sind und wo nachjustiert werden muss.
Fazit: Evolution als Erfolgsfaktor
Wer sein System nur einmal aufsetzt und dann sich selbst überlässt, wird früher oder später vor einem überholten, ungenutzten Monolithen stehen. Denn ein System, das mit seinen Nutzern wächst, wird nicht nur toleriert. Es wird geschätzt. Es macht Teams schneller, Produkte konsistenter und Design-Entscheidungen nachhaltiger.
Evolution ist weniger ein Problem sondern viel mehr eine Chance. Wer sein Design-System wie ein Produkt behandelt, also mit Roadmap, Nutzerfeedback und kontinuierlicher Verbesserung, schafft mehr als bloße Konsistenz.
Es entsteht eine tragfähige Design-Infrastruktur, die skaliert und echten Mehrwert liefert.

Die Konferenz für User Experience und Entwicklung im KI-Zeitalter ⟡
19.03.2026 // 12:15 – 19:00 Uhr // Saarbrücken
- Deep-Dive in User Experience und moderne Entwicklung
- Kompakter Nachmittag mit hochkarätigen Sessions und praxisnahem Know-how
- Best Practices zur effektiven Integration von KI in UX
Auf der UXDEVCON 2026 erfahren Sie, wie moderne Teams Geschwindigkeit, Qualität und Skalierung unter einen Hut bringen und wie starke User Experience wirklich entsteht.
Mail und Telefon
Kontakt
Vereinbaren Sie einfach eine kostenlose und unverbindliche Erstberatung mit uns.